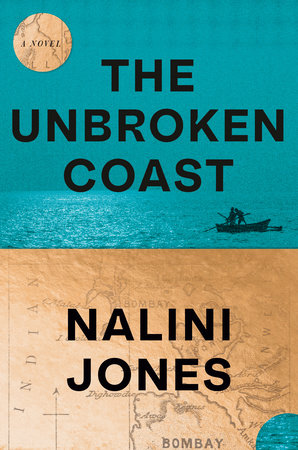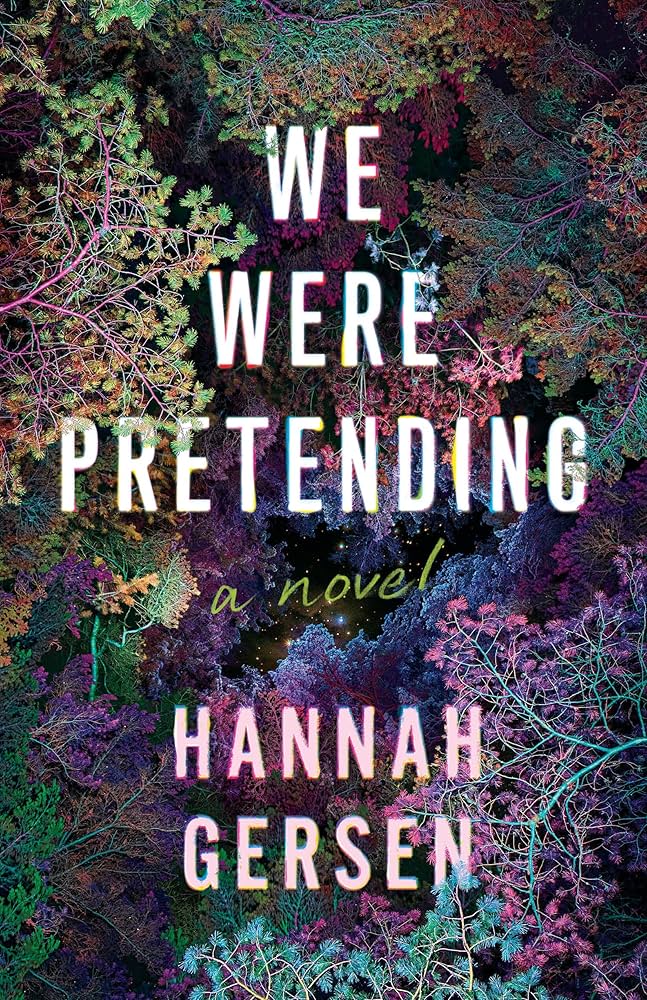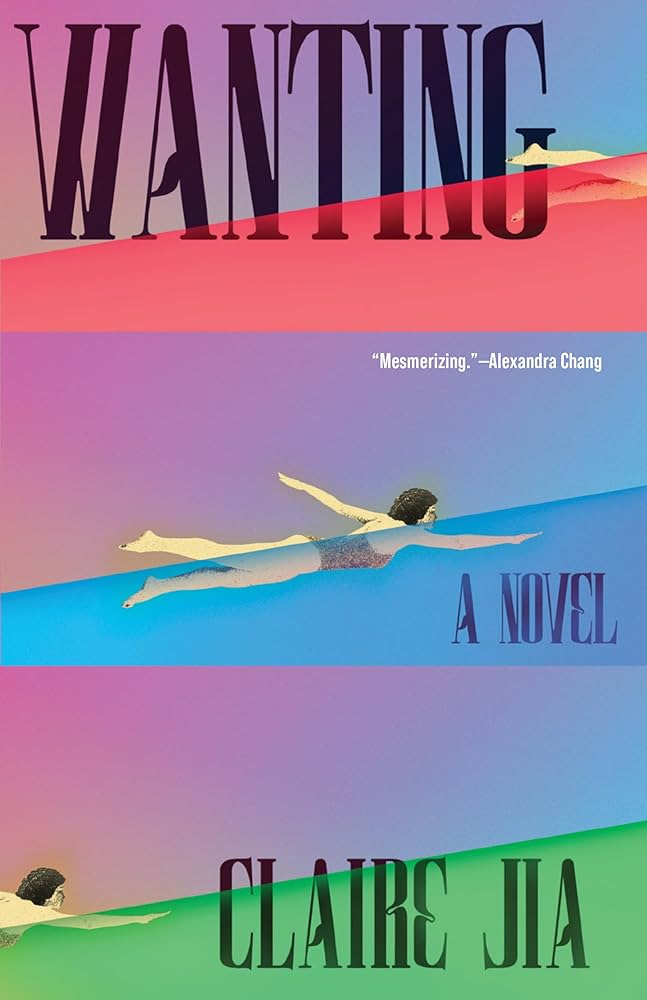Translated from the German by MELODY MAKEDA LEDWON
Translator’s Note
“I need you to translate my book. You’re the person I would ask,” Simoné said to me as we sat on a panel about intersectionality and translation at the Translationale Berlin in the winter of 2023. We laughed briefly at how she had managed to weave this translation proposal into her response to a question about challenges in the German translation industry. Honored, intrigued, a bit nervous, I accepted.
Messer, Zungen, written primarily in German, explores how the erasure of Black people and people of color from the culture of remembrance within the Cape Coloured community in South Africa, also known as Camissa, is intimately tied to their displacement from ancestral lands and historic communal sites. Resisting racial violence, reclaiming memory, history and language therefore involves both returning to lost places and being resilient in hostile spaces. I found the role of language in this context particularly fascinating. The characters speak, remember, and experience their worlds in multiple languages, including Sesotho, English and Afrikaans, creating a mosaic of languages. In my initial draft of “Choir” and “Motherness,” I focused on how to recreate this rich tapestry of language in translation. As I began to revise, and consult with SGL and several colleagues, I concluded that it was most important to respect the characters’ language choices. Above all, I sought to capture the commonplace reality of multilingual worlds and communities. SGL adeptly portrays these realities in her novel without explaining them or making them more palatable to an imagined external audience. In contrast to the original, where passages written in English stand out, in the translation they seamlessly blend into the main language of the text, resulting in a new language mosaic.
—Melody Makeda Ledwon
Knives, Tongues
Choir
The paths are drawn on the ground before the borders appear. We buried water and supplies there, made this barren ground walkable, and moved from the north to the south until we reached the clashing oceans, green and blue. You think about the calloused soles of our feet, we think about our siblings: The one who quickly knew all the paths, the one whose stories made us giggle. We think about the one who tamed snakes with a meerkatte that couldn’t keep its balance, did not stumble or eat sand (at least that’s how you’ll tell it later); the art of some, the courage of others. We remember the years when ships shattered on cliffs, friendships formed, fights and wars flamed, slates wiped clean, and when we laughed and cried. We recall the beat of our own words, not their rhythm–those thoughts belong to you. We don’t think about ourselves as separate from others among us–those thoughts belong to you. When you drag our siblings to exhibitions, physiognomic examinations, and shooting ranges, we will remember.
We remember, but not like elephants returning to burial sites, because our memories do not fit between book covers, between opening and closing credits. Not like these tsotsis and these Soweto mothers; our Gods were never crazy.
Still, we remember and take our memories with us on our journeys. And when you no longer let us walk our journey’s paths, when you become part of us and simultaneously place others in us, enslaved peoples from elsewhere, enslaved peoples from here, when you create this violent “we,” water veins will still run in the same places. When you force us to stop, we will still tell our descendants which paths to take and which to avoid, mapping minds until they know where everything is–the places where we hid supplies, buried water, and made the ground walkable. We draw roads deep into their brains; those that no longer exist and those you couldn’t possibly know about. You wouldn’t know about them because we are not allowed to exist. Each of the names you give us, which suddenly become more important than creating worlds, all mean “human” in our splintered languages. But when you use these names for humans they mean “less than,” and if we complain, it is not artful enough, howling like animals in the night, always less than, too sensitive for your ears, always too sensitive. That’s when we become humans, but not humans like you. That’s when we become Soweto mothers and tsotsis. Our gods must be crazy because it is your gods, or at least your words, that you cut from our tongues.
But you, you remember it differently. You never remember how often we fought back. You never remember Makana and Mlawu, and only occasionally Shaka. You never remember the names you did not give us.
Motherness
Mother is created opposite the meadow where red daisies bloom. She falls off as mineral accumulation of large, imposing rocks, lands softly, and forms anew. She carries stones, that have lost their connection to the earth’s crust from the wayside to the terrace, placing them next to one another. The brothers sprint from the parents’ home past her, their bare feet splashing rhythms onto the terracotta tiles of the terrace. Mother’s dress briefly dances in the rising winds, she remains still and focused. Mother begins her science class. She learns that shadows cast by stones behave differently here than elsewhere. Mother is Father’s favorite child. Sometimes, little Brother must be punished because he uses words that are unacceptable. Then Father tearfully takes the soap and washes out the child’s soft mouth, palate, and tongue. He doesn’t want to do it, of course. He must. Mother is spared. She sits on her grandmother’s bed among many children. Grandmother’s soft hands run through her hair. Lily-white, avoid the sun, but you look like an urchin, your thick black, thick black hair, not so lily-white, not so fair. Mother accepts these words, learns how to deal with them, and then soaks them up for later when she is facing her daughter. Father is also good with words. He writes speeches for schoolchildren, just like his wife. He writes speeches for the streets. They call Mother “four-eyes,” someone at Varsity calls her “pretty girl” and sings, “Don’t know much about history.” Mother responds, “But you should.” He replies, “Know-it-all,” even though Mother knows nothing.
Mother is searching.
What is left of Mother after she reads Rilke and decides to learn German? A lot remains obscured, always an unknown variable. If she says she is not available, could the child’s father go for a walk with the girl? Mother’s unstraightened hair remains on the pillow, spreads out and leaves furrows on the rose-printed fabric. She stares at the ceiling until Father and the child return.
“I told you not to go to McDonald’s,” she says wearily. Pink jogging pants embracing her legs, the child snuggles up to Mother’s scent, and laughs into the soft crook of her arm. In one swift move, the child shifts around this motherly corpus delicti. Years prior, the child’s father tries to get mangoes from a mini-mart, but he can’t find any and that makes Mother cry more than being alone all this time.
Sometimes Mother remembers the sand on the asphalt: fine-pored, splintered stones on scraggy surfaces, unyielding and knifelike. Yet, sand slips through, encroaching on nostrils and lungs. Even after parting ways with the asphalt, the sand remains. Mother was a social worker back then. In a system dominated by hostile projections, only trade and technical school degrees are available to people like her. They remove a boy from his family and take him to their supervisors before he is placed in a group home. Mother is out with a colleague, Uncle K. or Uncle R.; she doesn’t recall anymore. They are at a traffic light when the boy suddenly pushes the door open and sprints away. Mother takes off after him across the scorching asphalt, removing her white high heels as she runs. She catches up to him before he reaches his top speed. When she grabs his arm, he turns around with eyes wide from the drugs, the corners of his mouth torn. He doesn’t need to beg or plead with her to turn away and loosen her grip on his hand. She gets back in the car and exchanges pleased looks with Uncle, because at least this boy will destroy himself on his own terms by inhaling sand into his lungs. They watch as the city swallows him.
When Mother arrives, Aunt S. asks the child’s father: “Was kann’s denn kochen, was du isst?” – What can she cook that you will eat? She replies, “Meatballs.” She makes excellent meatballs, seasoning the minced meat well, kneading it thoroughly, and forming evenly sized servings. Peace and quiet, her old enemy, is the key to kneading well, and Mother has learned to get on with him. Exhausted by the kneading, she has no energy left to fry potatoes. “Put flour,” she directs the child’s father in German, “then turns on pot.”
Over the years, Mother has written down the things she cannot get. She is told at the federal and state offices that her degree does not qualify her to work here. She contemplates explaining everything. The fact that she moved away to attend secondary school and was the only one who received honors in her year. She wants to explain all this, but as Rilke writes, the most blessed knowledge is becoming a beginner. So, Mother becomes a housewife.
Years earlier, P. was in a workshop, blowing glass, and making lamps for the village. Mother lies on a bench. Wood rubs against her hair and chafes the backs of her knees as her legs dangle over the bench’s edge. She observes the sticky mass turn into a glimmering ball at the end of the blowpipe. “It is important,” P. says, “to make sure the glass is equally thick on all sides. Otherwise, the pressure may carve cracks into it, causing it to shatter once cooled.” Later, Mother counts the cracks in the walls of her room: two, four, five, all the way up to eight, and back again.
When heat overlaps in ways that stop Mother’s breathing, she muses that she was made this way, pushed into the hot goal, and inflated with words until she can no longer think. She walks around with all those cracks she stopped feeling. Mother notices that every word she speaks could turn into a new disaster. Daughter also realizes this. She learns which words to speak freely and which to weigh carefully: fat, ugly, ay, sies tog. Daughter sits on the floor in front of the mother, her eyes fixed to the flickering screen as Mother runs her fingers through Daughter’s hair. “Black and fine, and fine, her skin soft and peachy. A shame she doesn’t have your husband’s blue eyes,” Grandmother would have said, “a shame.” Shame that is passed down from one generation to the next. Mother has fought for years and continues to fight for this body and all the others she so despises–ashamed. She fights for the boy’s body too, even weeks after they let him go. And for another boy’s body, found between empty soda cans and hot corrugated metal sheets. A body full of flies, lying motionless between newspapers. “Freedom,” Mother thinks. The poster she takes with her on the bus ride home reads “Freedom” in big bold letters. Freedom, yet the bus is stopped. Mother holds her breath and counts backwards: eight, seven, six, five. Four of her fellow students are taken away. Mother never sees them again. “Lucky they couldn’t see freedom,” she will say later, but think about the boy between the cans, his gaunt legs, scraped knees, the flies on his dull pupils, and his stiff hands balled up into fists. She will think about him when she’s far away with the children and their father, while aunts’ share recipes and doctors’ write prescriptions, and while the children scream and call out for her. She will always think about the flies and the boy–always.
When they return, change is in the air. If Mother stops moving, her children will start to tug at her, climb into bed with her and cover their eyes with their hands, just the way they’ve seen her do. Lightning splits the purple sky, Mother pulls her children close. She presses her lips together because stormy nights unleash torrents, father writes speeches opposing the system, and the brothers return in a car that is not theirs. The officers drag them over the terracotta tiles into the house. Blood drips from Little Brother’s temple onto the carpet. Across from the house, in the meadow, flowers succumb to the wind’s pressure. Their heads are snapped off, their stems buckle.
“Sir, your sons have been accused of accosting a woman along the R4. This is very serious, sir. The woman will be pressing charges, sir.”
With every “sir,” the officer spits contempt from his mouth. Grandmother and Grandfather freeze, unable to utter a single word. Little Brother tries to speak but every attempt to talk to these two faceless men is pointless. Mother does not recall what exactly happened. She only remembers more blood dripping onto the carpet because of this woman, lily-white and fair. Then she remembered that both brothers were on their way to P., headed in the opposite direction. All they need to do is call him. Just call him. Luckily, big Brother left his beret at P.’s house. Luckily, P. is lily-white himself and not yet a traitor, not yet a terrorist. Later, Father gets a bucket of water and soap and scrubs the carpet fibers for hours.
The children’s heroes are Yellow Ranger, Raphael, and Sailor Mars. They live in black-and- white worlds, clad in their knickerbocker pants. There is no way to explain the fears in the in-between spaces, the gray areas. And yet, years later, Daughter stands in front of her, but Mother does not recognize her and fails to understand why she pays so much attention to these small differences. “Didn’t we come to Germany, so you’d be safe?” This couldn’t possibly affect her. Not her–she has fine hair, that glides through your fingers with such ease and doesn’t have to be straightened or pressed. Mother feels relieved when doctors hold up CT scans and point to the dark spots that have spread throughout her uterus. “You see, all of this has to be removed,” they say. Mother recognizes the patterns and smells the brutality between corrugated sheet metal and plastered walls. Mother wants to learn how to swallow the anger she feels when listening to her daughter who is unfamiliar with this smell, who lets herself go until she completely disappears between words that cannot be translated. But too many years have passed. Suddenly, Mother wants to scream: “You care about these things? What about all those years when you refused to speak my language? And when you hid from the sun with me, with your peachy skin, like a fake Lily–what about that?”
What is left of Mother in these growing rings? There is nothing new under the sun, only lies. She hates forming meatballs in her hands, digging in the sticky mass again and again. They pull the awful lump from between her legs. The doctors show her the mucosal flesh after the successful operation. They speak loudly and clearly. Mother smiles faintly and nods after seeing what emerged from her body. She is sure that the black dots in her field of vision are the same as those on the x-ray images. Nothing new about her body, she had always thought. What a relief that her body is not rigid and immobile after all, that the cracks are where they had always been. She begins to feel them while counting: two, four, five, and back again.
Occasionally, Mother remembers the hard floor. When she inhales, she smells the boy, her nieces, and nephews, sleeping on the streets between corrugated metal sheets and plastered walls. When she exhales, she sees sand particles forming in the air, carried away by the wind until they stick to the walls. Occasionally she sees Daughter standing between the walls, counting the cracks in the plaster, two, four, five, and back again until there are none left.
Messer, Zungen
Chor
Die Wege sind in die Erde gezeichnet, ehe die Grenzen entstehen. Wir haben dort Wasser vergraben und Vorräte, diesen kargen Boden gangbar gemacht oder sind von Norden südwärts gezogen, bis wir die Meere erreichten, die dort aufeinandertrafen, grün und blau. Ihr denkt an die verhornten Unterseiten unserer Füße, wir an unsere Geschwister. An die, die schnell schon die Wege kannte, an den, dessen Geschichten uns zum Lachen brachten. An die, die mithilfe der meerkatte (so sagt ihr es später) Schlangen zähmte, die weder Gleichgewicht besaß, stolperte noch Sand fraß, an die Kunst der einen, den Mut der anderen. Wir denken an die vielen Jahre, in denen die Schiffe an Klippen zerschellten, diese Jahre, während denen Freundschaften entstanden, Streit und Krieg entbrannten, Frieden geschlossen, gelacht und geweint wurde. Wir denken an den Takt unserer eigenen Worte, nicht an den Rhythmus, denn diese Gedanken gehören ganz euch. Wir denken nicht wir und die anderen unter uns, denn diese Gedanken gehören ganz euch. Doch wenn ihr später unsere Geschwister auf Ausstellungen, Vermessungen, Schießstände schleppt, dann denken wir daran.
Wir erinnern uns, aber nicht wie Elefanten, die auf Friedhöfe zurückkehren, denn unsere Erinnerungen passen nicht zwischen Buchrücken, zwischen Vor- und Abspann. Nicht wie die Tsotsis, diese Sowetomütter, und unsere Götter waren nie verrückt.
Und trotzdem erinnern wir uns und nehmen das mit auf unseren Wegen. Und wenn ihr manche von uns diese Wege nicht länger gehen lasst, wenn ihr Teil von uns werdet und gleichzeitig andere in uns versetzt, Versklavte von anderswo, Versklavte von hier, wenn ihr dieses gewaltvolle Wir schafft, dann verlaufen trotzdem an denselben Stellen Wasseradern. Wenn wir stehen bleiben müssen, dann erzählen wir trotzdem unseren Nachfahren, welche Wege sie abgehen, welche sie meiden müssen, kartografieren ihre Köpfe so lange, bis sie wissen, wo alles liegt. Wo wir Vorräte versteckt und Wasser vergraben haben. Wo wir den Boden gangbar gemacht haben. Wir fügen tief in ihre Gehirne die Straßen ein, die es gab, die, von denen ihr nichts wissen könnt. Von denen ihr nichts wissen könnt, weil es uns nicht geben kann, und alle Namen, die auf einmal bedeutender sind als die Erschaffung von Welten, alle Namen, die ihr uns aus unseren zerbrochenen Sprachen gebt, heißen Mensch. Aber wenn ihr sie verwendet, diese Menschennamen, dann ist das less than, und wenn wir klagen, dann zu wenig kunstvoll, dann heulen wir wie die Tiere, immer less than, in der Nacht für eure Ohren zu empfindlich, immer zu empfindlich. Dann werden wir Menschen, aber nicht wie ihr. Dann werden wir Sowetomütter und Tsotsis für euch. Dann müssen unsere Götter verrückt sein, weil es eure Götter sind oder zumindest eure Wörter, die ihr aus unseren Zungen herausgeschnitten habt.
Ihr aber, ihr erinnert euch, anders. Nie daran, wie oft wir euch zurückschlugen. Niemals an Makana oder Mlawu, selten an Shaka. Nie an Namen, die ihr uns nicht gegeben habt.
Ermutterung
Die Mutter wird gegenüber der Wiese erfunden, auf der rote Margeriten blühen, fällt dort ab als Mineralansammlung von großen, imposanten Felsen, landet weich und formt sich neu. Vom Wegrand trägt sie Steine mit sich auf die Terrasse, die ihren Bezug zur Erdkruste verloren haben, und stellt sie nebeneinander. Die Brüder rasen aus dem Elternhaus an ihr vorbei, ihre nackten Füße platschen Rhythmen auf die Terrakottaplatten der Terrasse, und Mutters Kleid bewegt sich kurz im aufkommenden Wind, aber sie bleibt still und konzentriert. Mutter beginnt mit ihrem Sachkundeunterricht. Später wird sie verstehen, dass die Schatten, die die Steine werfen, sich hier anders verhalten als überall sonst. Mutter ist Vaters liebstes Kind. Der kleine Bruder muss manchmal bestraft werden, der nimmt Worte in den Mund, die so nicht gehen, und Vater nimmt dann weinend die Seife zur Hand und wäscht den weichen Kindermund aus, den Gaumen und die Zunge. Er will das nicht, natürlich nicht. Er muss. Mutter aber bleibt davon verschont. Mutter sitzt auf dem Bett der Großmutter, eines von vielen Kindern. Diese weichen Hände fahren ihr durchs Haar, lily white, avoid the sun, but you look like an urchin, your thick black, thick black hair, not so lily white, not so fair. Mutter nimmt die Worte an, sie lernt mit den Worten umzugehen, saugt sie in sich auf für später, wenn sie ihre Tochter vor sich sieht. Auch der Vater kann das gut, kann gut mit Worten umgehen, schreibt Reden für die Kinder, die Schulbänke drücken, so wie Vaters Frau, schreibt Reden für die Straßen. Sie nennen Mutter four eyes, einer auf der Universität sagt pretty girl zu ihr, singt: „Don’t know much about history“, und Mutter erwidert: „But you should“, und er sagt: „Know-it-all“, aber Mutter weiß nichts.
Mutter sucht –
Was bleibt von Mutter, nachdem sie Rilke liest und beschließt, Deutsch zu lernen? Viele Dinge bleiben unbekannt, dieser Faktor X. Wenn sie sagt, sie könne nicht, ob dann der Kindesvater, dieser Vater, ob er nicht mit dem Mädchen spazieren gehen könnte. Mutters Haare bleiben dann ungeglättet auf dem Kissen liegen, breiten sich überall hin aus, Furchen in den Kissen mit dem Rosenaufdruck. Sie starrt dann deckenwärts bis Kindesvater und Kind zurückkehren.
“I told you not to go to McDonalds”, sagt sie müde. Das Kind trägt rosa Jogginghosen, kuschelt sich ran an den Mutterduft und lacht in die weiche Armbeuge, umturnt diesen Mutter corpus delicti, und der Kindesvater versucht vorher, Jahre vorher, Mangos aus dem Minimarkt zu holen, aber das geht nicht, und das bringt Mutter mehr zum Weinen als all dieses Alleinsein.
Manchmal denkt Mutter zurück an den Sand auf dem Asphalt, zersplitterte, feinporige Steine auf groben Steinflächen, beides hart und scharf, aber der Sand gleitet hindurch und lässt sich einatmen. Der bleibt auch dann, wenn man den Asphalt verlassen hat. Damals ist Mutter Sozialarbeiterin. Nur Fachhochschulabschlüsse sind möglich für solche wie sie im heimatlichen System, das aus feindseligem Zuschreiben besteht. Einen Jungen holen sie aus seiner Familie, sie müssen ihn zu den Vorgesetzten bringen, ehe er ins Pflegeheim übermittelt werden kann. Mutter ist mit einem Kollegen unterwegs, Uncle K. oder Uncle R., genau weiß sie es nicht mehr. Sie stehen an der Ampel, und der Junge reißt die Tür auf und sprintet los. Mutter stürzt hinterher, über den heißen Asphalt, zieht im Laufen die hochhackigen weißen Schuhe aus und schafft es, ehe der Junge seinvolles Sprinttempo erreicht hat, aufzuschließen. Sie packt ihn am Arm, er dreht sich zu ihr um, weitäugig von den Drogen, die Mundwinkel eingerissen. Er muss nicht flehen oder betteln, damit sie kurz wegblickt, kurz nur die Hand lockert. Sie steigt zurück ins Auto, und der Uncle und sie tauschen einen zufriedenen Blick aus, denn wenigstens dieser Junge wird sich zu seinen eigenen Bedingungen zerstören, wird den Sand einatmen in seine Lungen. Sie beobachten gemeinsam, wie er von der Stadt verschlungen wird.
Als Mutter in Deutschland ankommt, fragt Tante S. den Kindesvater: „Was kann’s denn kochen, was du isst?“ Und Mutter erwidert: „Frikadellen.“ Und sie macht gute Frikadellen, sie würzt das Hackfleisch richtig, knetet es durch und formt gleichmäßig große Kugeln. Die Ruhe ist der Schlüssel beim Kneten, der alte Feind, und Mutter hat sich mit ihm eingerichtet. Das Kneten erschöpft sie so, dass keine Energie mehr bleibt für die Bratkartoffeln. „In den Mehl einlegen“, weist sie den Kindesvater an, „dann die Topf anmachen.“
Über die Jahre hat Mutter die Dinge aufgeschrieben, die sie nicht bekommen kann. Das fängt an im Amt, als ihr erklärt wird, dass ihr Abschluss hier zum Arbeiten nicht reicht. Sie überlegt, alles zu erklären: das Wegziehenmüssen für die höhere Schule, dass sie als Einzige ihres Jahrgangs überhaupt einen Honours-Abschluss geschafft hat; sie überlegt sich, all das zu erklären, aber Rilke schreibt kein seligeres Wissen, als dass man ein Beginner werden muss, also wird Mutter Hausfrau.
Früher bläst P. in der Werkstatt Glas, fertigt Lampen an für das Dorf. Mutter liegt auf der Bank. Ihre Haare reiben sich am Holz auf, und die Kniekehlen auch, dort, wo ihre Beine über das Ende der Bank baumeln. Sie beobachtet, wie die klebrige Masse erhitzt wird und daraus am Ende des Blasstabes eine glimmende Kugel wird. Wichtig sei, sagt P., darauf zu achten, dass das Glas überall gleich dick werde. Sonst komme es zu Spannungsrissen, dann könne es nach dem Abkühlen platzen. Mutter zählt später die Risse in den Wänden ihres Zimmers, zählt sie auf und wieder ab, zwei, vier, fünf bis acht.
Mutter denkt später bei manchen Berührungen, wenn zum Beispiel die Hitzen sich so überlappen, dass sie nicht mehr zum Atmen kommt, dass sie selbst so gemacht wurde, selbst in die Glut getrieben und mit diesen Worten aufgeblasen wurde, bis sie nicht mehr denken konnte. Dass sie nun herumläuft mit all diesen Rissen, die sie nicht mehr spürt. Jedes Wort, das sie sagt, merkt Mutter, kann ein neues Verhängnis sein. Die Tochter merkt das auch, merkt, welche Worte man auf die Goldwaage legen kann und welche nicht. Fat, ugly, ay, sies tog. Die Tochter sitzt vor ihr auf dem Boden, die Augen mit dem flimmerndem Bildschirm verwachsen, und Mutter fährt ihr durchs Haar, schwarz und fine und fine, die Haut weich und peachy, aber a shame she doesn’t have your husband’s blue eyes, hätte Großmutter gesagt, a shame, eine, die sich wieder und wieder überträgt, auch während Mutter kämpft, all die Jahre und auch jetzt immer noch, auch während sie kämpft für diesen und all die anderen Körper, die sie so verachtet, ashamed. Auch für den Körper des Jungen, Wochen später, nachdem sie ihn losgelassen haben in der Stadt, oder vielleicht einen anderen, für den Körper, den sie finden zwischen leeren Konservendosen, zwischen erhitztem Wellblech, dieser Körper voller Fliegen, regungslos zwischen den Zeitungspapieren. Freiheit, denkt Mutter. Freedom steht auch auf dem Poster, dass sie mitnimmt auf den Bus zurück, heimwärts. Freedom, aber der Bus wird angehalten. Mutter hält die Luft an und zählt rückwärts, acht, sieben, sechs, fünf. Vier der Kommilitoninnen werden mitgenommen. Mutter sieht sie nie wieder. „Lucky they couldn’t see freedom“, wird sie später sagen, aber dabei an den Jungen denken zwischen den Konservendosen, an seine dürren Beine und die aufgeschürften Knie, an die Fliegen auf seinen stumpf gewordenen Pupillen und seine zu Fäusten geballten, steif gewordenen Hände. Sie wird daran denken, während sie weit davon entfernt sein wird mit den Kindern und dem Kindesvater, während ihr Rezepte in die Hand gedrückt werden von Tanten und Ärzten und die Kinder brüllen und nach ihr rufen, immerzu wird sie an die Fliegen denken und an den Jungen.
Als sie zurückkehren, liegt der Wandel in der Luft. Wenn Mutter trotzdem regungslos wird, dann reiben sich die Kinder an ihr auf, dann klettern sie in ihr Bett und legen sich die Hände über die Augen, wie sie es bei ihr gesehen haben. Draußen reißen Blitze den lilaroten Himmel auf, und Mutter zieht die Kinder an sich. Sie presst Lippen zusammen, fest zusammen, denn alles quillt über in Gewitternächten, denn Vater schreibt Reden gegen das System, und die Brüder kehren mit dem Auto zurück, aber nicht mit ihrem. Die Beamten schleppen sie über die Terrakottaplatten ins Haus, und Blut tropft von der Schläfe des kleinen Bruders auf den Teppichboden. Auf der Wiese gegenüber halten die Blumen dem Wind nicht mehr stand, ihre Köpfe knicken ein.
„Sir, your sons have been accused of accosting a woman along the R4. This is very serious, sir. The woman will be pressing charges, sir.”
Und bei jedem sir spuckt der Beamte seine Verachtung mit aus, aber Großmutter und Großvater sind erstarrt, sind ganz erstarrt und bringen kein Wort mehr über die Lippen. Der kleine Bruder versucht vielleicht zu sprechen, aber jeder Versuch ist sinnlos zwischen diesen beiden gesichtslosen Männern. Mutter kann sich nicht mehr genau erinnern, nur dass mehr Blut auf den Teppichboden tropft wegen dieser Frau, dieser Frau, lily white and fair, bis ihr einfällt, dass beide Brüder auf dem Weg zu P. waren, dass das die andere Richtung sei, man müsse dort nur anrufen, einfach anrufen. Zum Glück hat der große Bruder sein Barett bei P. liegen gelassen. Zum Glück ist P. selbst lily white und noch kein Verräter, noch kein Terrorist. Später holt Vater einen Eimer Wasser und die Seife und reibt sie über die Teppichfasern, stundenlang.
Für die Kinder heißen Heldinnen Yellow Ranger und Raphael und Sailor Mars. Sie leben in Schwarz-Weiß-Welten, diese Kinder in ihren Knickerbockerhosen, keine Gründe für die Ängste dazwischen, die grauen. Und doch steht Jahre später die Tochter vor ihr und Mutter kann sie nicht erkennen, kann nicht verstehen, warum sie so sehr auf diesen kleinen Unterschieden beharrt, denn „Didn’t we come to Germany so you’d be safe?“, denn das kann doch nicht auf sie zutreffen, nicht auf sie, mit den Haaren, die so fine sind, mit diesen Haaren, die so leicht über die Finger gleiten, die weder geglättet noch gepresst werden müssen. Es ist eine Erleichterung für Mutter, als der Arzt ihr die CT-Scans zeigt, auf die dunklen Flecken deutet, die sich in ihrer Gebärmutter ausgebreitet haben: „Schauen Sie, das muss alles entfernt werden.“ Mutter erkennt die Muster, kann das Verrohte riechen zwischen Wellblech und verputzten Wänden. Die Wut, wenn sie der Tochter zuhört, die diesen Geruch nicht kennt, die sich so gehen lässt, bis sie ganz zwischen Worten verschwunden ist, die nicht übersetzbar sind, diese Wut möchte Mutter gerne schlucken lernen, aber dafür sind viel zu viele Jahre vergangen. Auf einmal, möchte Mutter brüllen, interessiert dich das, und all die Jahre vorher, als du meine Sprache nicht sprechen wolltest, als du dich mit mir vor der Sonne versteckt hast mit deiner peachy Haut und eine falsche Lily warst, was ist damit?
Was bleibt von Mutter in diesen wachsenden Ringen? In keiner Himmelsrichtung etwas Neues, alles Lügen, und sie hasst das, immer wieder Frikadellen zwischen ihren Händen zu formen, immer wieder in dieser klebrigen Masse zu wühlen. Sie ziehen das unliebsame Ding zwischenihren Beinen heraus, die Ärzte, zeigen ihr diesen Schleimhaut-Fleischklumpen nach dem erfolgreichen Eingriff und sprechen laut und deutlich. Mutter lächelt schwach und nickt, als sie sieht, was da in ihrem Körper war, und sie ist sich sicher, dass die schwarzen Punkte in ihrem Sichtfeld dieselben sind wie die auf den durchleuchteten Bildern. Im Körper nichts Neues, hätte sie gedacht, aber was für eine Erleichterung, dass er doch nicht starr und unbeweglich ist, dass doch alle Risse dort sind, wo sie waren, dass sie spürbar werden beim Auf- und Abzählen. Manchmal denkt Mutter zurück an den harten Boden. Wenn sie einatmet, riecht sie zwischen Wellblech und verputzten Wänden diesen Jungen, ihre Nichten und Neffen, schlafend auf den Straßen. Wenn sie ausatmet, kann sie die Sandpartikel sehen, die sich in der Luft bilden, die vom Wind weggetragen werden, bis sie an den Wänden kleben bleiben. Manchmal sieht sie die Tochter zwischen den Wänden stehen, wie sie dort im Putz die Risse zählt, aufwärts und abwärts, bis keine mehr bleiben.
Simoné Goldschmidt-Lechner (SGL) is a writer and translator interested in queer online fandoms and (postmigrant) horror narratives. Excerpts from Simoné’s first novel, Messer, Zungen, were nominated for the 28th Open Mike. Simoné’s bilingual novella Days you’ll find me (in a place you like to go) was awarded Book of the Year by the Hamburg Literature Awards.
Melody Makeda Ledwon is a bidirectional translator (German/English). Her work explores multilingual afrodiasporic stories. Melody’s (co-)translations include, Vierhundert Seelen: Die Geschichte des Afrikanischen Amerika 1619-2019 and Angela Y. Davis: Eine Autobiographie. Her translation “Beach Penguins” by SGL is forthcoming in World Literature Today.